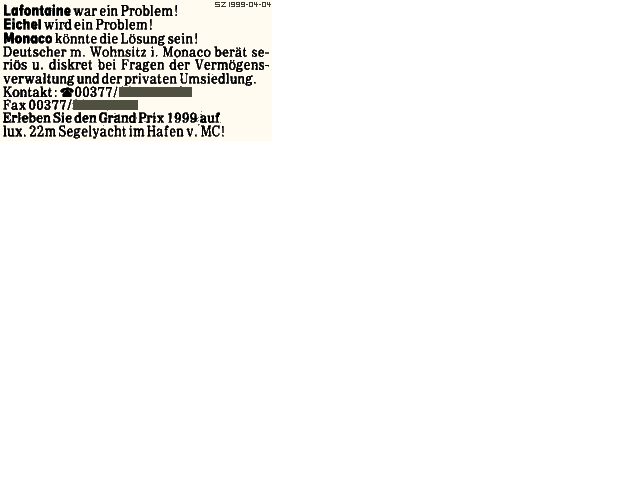Der Weg nach vorne für Europas Sozialdemokraten
Ein Vorschlag von Gerhard Schröder und Tony Blair
In fast allen Ländern der Europäischen Union regieren Sozialdemokraten. Die Sozialdemokratie hat neue Zustimmung gefunden - aber nur, weil sie glaubwürdig begonnen hat, auf der Basis ihrer alten Werte ihre Zukunftsentwürfe zu erneuern und ihre Konzepte zu modernisieren. Sie hat neue Zustimmung auch gewonnen, weil sie nicht nur für soziale Gerechtigkeit, sondern auch für wirtschaftliche Dynamisierung und für die Freisetzung von Kreativität und Innovation steht.
Markenzeichen dafür ist die "Neue Mitte" in Deutschland, der "Dritte Weg" im Vereinigten Königreich. Andere Sozialdemokraten wählen andere Begriffe, die zu ihrer eigenen politischen Kultur passen. Mögen Sprache und Institutionen sich unterscheiden: Die Motivation ist die gleiche. Die meisten Menschen teilen ihre Weltsicht längst nicht mehr nach dem Dogma [?] von Links und Rechts ein. Die Sozialdemokraten müssen die Sprache dieser Menschen sprechen.
Fairneß, soziale Gerechtigkeit, Freiheit und Chancengleichheit, Solidarität und Verantwortung für andere: diese Werte sind zeitlos. Die Sozialdemokratie wird sie nie preisgeben. Um diese Werte für die heutigen Herausforderungen relevant zu machen, bedarf es realistischer und vorausschauender Politik, die in der Lage ist, die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu erkennen. Modernisierung der Politik bedeutet nicht, auf Meinungsumfragen zu reagieren
[landesweite Meinungsumfrage alle vier Jahre], sondern es bedeutet, sich an objektiv veränderte [von wem?] Bedingungen anzupassen.
Wir müssen unsere Politik in einem neuen, auf den heutigen Stand gebrachten wirtschaftlichen Rahmen betreiben, innerhalb dessen
der Staat die Wirtschaft nach Kräften fördert,
sich aber nie als Ersatz für die Wirtschaft betrachtet. Die Steuerungsfunktion von Märkten muß durch die Politik ergänzt und verbessert, nicht aber behindert werden. Wir unterstützen eine Marktwirtschaft, nicht aber eine Marktgesellschaft!
["The decline of the nonaligned movement and of Western social democracy are two parts of the same picture. Both reflect the radicalization of the modern socio-economic system, where more and more power is put into the hands of unaccountable institutions that are basically totalitarian (though they happen to be private, and cruically reliant on powerful states)." (Noam Chomsky, 1997)]
Wir teilen ein gemeinsames Schicksal in der Europäischen Union. Wir stehen den gleichen Herausforderungen gegenüber: Arbeitsplätze und Wohlstand fördern, jedem einzelnen Individuum die Möglichkeit bieten, seine eigenen Potentiale zu entwickeln, soziale Ausgrenzung und Armut bekämpfen; materiellen Fortschritt, ökologische Nachhaltigkeit und unsere Verantwortung für zukünftige Generationen miteinander vereinbaren; Probleme wie Drogen und Kriminalität, die den Zusammenhalt unserer Gesellschaften bedrohen, wirksam bekämpfen und Europa zu einem attraktiven Modell in der Welt machen.
Wir müssen unsere Politik stärken, indem wir unsere Erfahrungen zwischen Großbritannien und Deutschland austauschen, aber auch mit den Gleichgesinnten in Europa und der übrigen Welt. Wir müssen voneinander lernen und uns an der besten Praxis und Erfahrung in anderen Ländern messen. Mit diesem Appell wollen wir die anderen sozialdemokratisch geführten Regierungen Europas, die unsere Modernisierungsziele teilen, einladen, sich an unserer Diskussion zu beteiligen.
I.
Aus Erfahrung lernen
Obgleich Sozialdemokraten und Labour Party eindrucksvoll historische Errungenschaften vorweisen können, müssen wir heute realitätstaugliche Antworten auf neue Herausforderungen in Gesellschaft und Ökonomie entwickeln. Dies erfordert Treue zu unseren Werten, aber Bereitschaft zum Wandel der alten Mittel und traditionellen Instrumente.
[Richtig: Neue Fragen erfordern neue Antworten. Aber die in diesem Papier deutlich werdende Fokussierung auf Wachstum und das Verharren im Denken des Wirtschafts-Liberalismus ist nur eine Beantwortung neuer Fragen mit sehr alten Antworten. Schröders "Modernisierung" ist ein verkappter Rückschritt. Die Ideen eines Adam Smith sind nur eingeschränkt in eine "moderne" Zeit übertragbar,
- in der sowohl sichtbare wie auch unsichtbare Hände ihre Umwelt ungleich verstärkter und schneller beeinflussen können (The amplified ape) als zu Smiths Zeiten,
- in der Geld und Informationen innerhalb von Mikrosekunden zwischen den Kontinenten transferiert werden können,
- in der 6 Milliarden Menschen leben, vehement begrenzte Resourcen beanspruchen und Abfallstoffe erzeugen,
- in der sich mit dem Rücken zur Wand stehende oder als Opfer fühlende Menschen mit dem vergleichbar geringem Aufwand einer modernen Bio-, Verkehrs-, Informations- und Waffentechnik sehr effizient werden zur Wehr setzen können. Nachtrag 2001-09-17:
"In my judgement, it's not a question of if there will be a biological or chemical weapons attack, but when - and of
which magnitude." (Rep. Christopher Shays, Republican US lawmaker and head of the
House Government Reform subcommittee on national security, 2001-09-15)
Speziell wegen der letzten beiden Punkte wird sich selbst der gegenwärtige Grad der Marktorientiertheit von Politik nicht halten lassen. Schröders "Modernisierung" greift nicht nur zu kurz, sondern sie will uns trotz in der Menschheitsgeschichte völlig neuer Problemstellungen mit neoliberalen Rezepten in die Vergangenheit zurückführen. Und ausgerechnet die Grünen machen dabei mit.]
- In der Vergangenheit wurde die Förderung der sozialen Gerechtigkeit manchmal mit der Forderung nach Gleichheit im Ergebnis verwechselt. Letztlich wurde damit die Bedeutung von eigener Anstrengung und Verantwortung ignoriert und nicht belohnt und die soziale Demokratie mit Konformität und Mittelmäßigkeit verbunden statt mit Kreativität, Diversität und herausragender Leistung. Einseitig wurde die Arbeit immer höher mit Kosten belastet.
- Der Weg zur sozialen Gerechtigkeit war mit immer höheren öffentlichen Ausgaben gepflastert, ohne Rücksicht auf Ergebnisse oder die Wirkung der hohen Steuerlast auf Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung oder private Ausgaben. [Soll daraus der unlogische Trugschluß abgeleitet werden, daß man man für geringere Ausgaben weniger soziale Gerechtigkeit akzeptieren müsse?] Qualitätvolle soziale Dienstleistungen sind ein zentrales Anliegen der Sozialdemokraten, aber soziale Gerechtigkeit läßt sich nicht an der Höhe der öffentlichen Ausgaben messen. Der wirkliche Test für die Gesellschaft ist, wie effizient diese Ausgaben genutzt werden und inwieweit sie die Menschen in die Lage versetzen, sich selbst zu helfen.
[Die Ansicht, daß der Staat schädliches Marktversagen korrigieren müsse, resultiert aus dem Gewahrwerden der Grenzen der Selbstheilungskräfte des Marktes und seiner Teinehmer. Unumkehrbarkeit setzt jeder Heilung Grenzen. Tod oder auch nur Lebensverkürzung sind unumkehrbar. Hier kann dann keine unsichtbare Hand mehr helfen. Aber auch der Verlust der Alterssicherung ist oft unumkehrbar:
"Up to 6,000 investors, many elderly, have been scammed in one of the largest insurance frauds in recent memory. Authorities say one man turned over as much as $3 million to companies that promised the funds would be used for lucrative life insurance policies for the terminally ill. Instead, says a federal indictment unsealed in West Palm Beach, Fla., the money was used to support lavish lifestyles, including resort homes, luxury cars and helicopters. Only about $6 million of the $115 million collected was used to buy legitimate policies, according to the indictment. Frederick Brandau, 54, of Davie, Fla.; an in-house attorney; a nurse and two of Brandau's companies -- Financial Federated Title & Trust Inc. and Asset Security Corp. -- were charged with 44 counts of wire and mail fraud, money laundering and conspiracy. The indictment was unsealed yesterday, hours after federal agents arrested Brandau at Miami International Airport. (Charles Bowen, CompuServe 1999/09/11)"]
 |
- Die Ansicht, daß der Staat schädliches Marktversagen korrigieren müsse, führte allzuoft zur überproportionalen Ausweitung von Verwaltung und Bürokratie, im Rahmen sozialdemokratischer Politik.
[Blair und Bundeskanzler Schröder verlieren hier den Bezug zur Realität. Siehe: "Tagebuch einer Handwerksfrau" (Das Bundeskanzleramt schickt den Sozialpsychiatrischen Dienst. Doch was Monika Schönemann verloren hat, ist ihr Betrieb), TAZ 2000/06/22 ]
Wir haben Werte, die den Bürgern wichtig sind - wie persönliche Leistung und Erfolg, Unternehmergeist, Eigenverantwortung und Gemeinsinn - zu häufig zurückgestellt hinter universelles Sicherungsstreben.
- Allzu oft [?] wurden Rechte höher bewertet als Pflichten. Aber die Verantwortung des einzelnen in Familie, Nachbarschaft und Gesellschaft kann nicht an den Staat delegiert werden. Geht der Gedanke der gegenseitigen Verantwortung verloren, so führt dies zum Verfall des Gemeinsinns, zu mangelnder Verantwortung gegenüber Nachbarn, zu steigender Kriminalität und Vandalismus und einer Überlastung des Rechtssystems.
- Die Fähigkeit der nationalen Politik zur Feinsteuerung der Wirtschaft hinsichtlich der Schaffung von Wachstum und Arbeitsplätzen wurde über-, die Bedeutung des einzelnen und der
Wirtschaft bei der Schaffung von Wohlstand
unterschätzt. Die Schwächen der Märkte wurden über-, ihre Stärken unterschätzt.
II.
Neue Konzepte für veränderte Realitäten
Das Verständnis dessen, was "links" ist, darf nicht ideologisch einengen.
- Die Politik der Neuen Mitte und des Dritten Weges richtet sich an den Problemen der Menschen aus, die mit dem raschen Wandel der Gesellschaften leben und zurechtkommen müssen. In dieser neu entstehenden Welt wollen die Menschen Politiker, die Fragen ohne ideologische Vorbedingungen angehen und unter Anwendung ihrer Werte und Prinzipien nach praktischen Lösungen für ihre Probleme suchen, mit Hilfe aufrichtiger, wohl konstruierter und pragmatischer Politik. Wähler, die in ihrem täglichen Leben Initiative und Anpassungsfähigkeit im Hinblick auf die wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen beweisen müssen, erwarten das gleiche von ihren Regierungen und ihren Politikern.
- In einer Welt immer rascherer Globalisierung und wissenschaftlicher Veränderungen müssen wir Bedingungen schaffen, in denen bestehende Unternehmen prosperieren und sich entwickeln und neue Unternehmen entstehen und wachsen können. [Raschere Globalisierung und wissenschaftliche Veränderungen verlangen wohl ein bißchen mehr, als nur prosperierende Unternehmen. Insbesondere das Schwinden der Bedeutung nicht direkt kommerziell nutzbarer naturwissenschaftlicher Forschung verursacht Probleme, die in Demokratien als überwunden galten. New Scientist 1999/06/05 S.3 (Hinweis auf den Index of Censorship): Zensur findet im wissenschaftlichen Bereich nun wieder statt.]
- Neue Technologien ziehen radikale Veränderungen der Arbeit sowie eine Internationalisierung der Produktion nach sich. [Treibende Kräfte in Richtung Internationalisierung der Produktion sind nicht neue Technogien, sondern (a) eine globale Arbeitsverteilung, die jedoch durch die Bewahrung regionaler Gebundenheit von Arbeitskräften profitabel bleibt und (b) die Notwendigkeit, marktnah zu produzieren.]
Einerseits führen sie dazu, daß Fertigkeiten verlorengehen und einige Wirtschaftszweige schrumpfen, andererseits fördern sie die Entstehung neuer Unternehmen und Tätigkeiten. Daher besteht die wichtigste Aufgabe der Modernisierung
["Ein neuer Glaube", Jan Roß, DIE ZEIT, 1999/29]
darin, in Humankapital zu investieren, um sowohl den einzelnen als auch die Unternehmen auf die wissensgestützte Wirtschaft der Zukunft vorzubereiten.
- Ein einziger Arbeitsplatz fürs ganze Leben ist Vergangenheit. Sozialdemokraten müssen den wachsenden Anforderungen an die Flexibilität
[Richard Sennet: Der flexible Mensch. Die Kultur des neuen Kapitalismus (Der Originaltitel ist treffender: Corrosion of Character)]
gerecht werden und gleichzeitig soziale Mindestnormen aufrechterhalten, Familien bei der Bewältigung des Wandels helfen und Chancen für die eröffnen, die nicht Schritt halten können.
- Wir stehen zunehmend vor der Herausforderung, umweltpolitische Verantwortung gegenüber künftigen Generationen mit materiellem Fortschritt für die Breite der Gesellschaft zu vereinbaren.
Wir müssen Verantwortung für die Umwelt mit einem modernen, marktwirtschaftlichen Ansatz verbinden. Was den Umweltschutz anbelangt, so verbrauchen die [Anwendungen der] neuesten Technologien weniger Ressourcen [allerdings nur bei gleichbleibendem Verbrauch (insbesondere Entropieexport) nach Anwendung dieser Technologien], eröffnen neue Märkte und schaffen Arbeitsplätze [nicht notwendigerweise].
- Die Höhe der Staatsausgaben hat trotz einiger Unterschiede mehr oder weniger die Grenzen der Akzeptanz erreicht. Die notwendige Kürzung der staatlichen Ausgaben erfordert eine radikale Modernisierung des öffentlichen Sektors und eine Leistungssteigerung und Strukturreform der öffentlichen Verwaltung.
Der öffentliche Dienst muß den Bürgern tatsächlich dienen: Wir werden daher nicht zögern, Effizienz-, Wettbewerbs- und Leistungsdenken einzuführen. [Das "Einführen" hat durchaus schon vor Schröder und Blair begonnen. Die resultierende Fokussierung auf Kostenreduzierung bezahlten zum Beispiel über hundert Kunden der Bahn AG mit ihrem Leben. (Siehe B.Busch: Entgleist und verspätet)]
- Die sozialen Sicherungssysteme müssen sich den Veränderungen in der Lebenserwartung, der Familienstruktur und der Rolle der Frauen anpassen. Sozialdemokraten müssen Wege finden, die immer drängenderen Probleme von Kriminalität, sozialem Zerfall und Drogenmißbrauch zu bekämpfen.
Wir müssen uns an die Spitze stellen, wenn es darum geht, eine Gesellschaft mit gleichen Rechten und Chancen für Frauen und Männer zu schaffen.
- Armut, insbesondere unter Familien mit Kindern, bleibt ein zentrales Problem.
[Armut gibt es auch bei den vielen alten Menschen, die zwar tausende von Mark pro Monat für einen Heimplatz (etwa 3000 bis 7000 DM pro Monat) zahlen können, aber keine Kontrolle mehr über die Verwendung ihres Geldes haben. Die Verhältnisse sind so miserabel, daß 8 von 10 Altenpflegern nach 5 Jahren ihren Job aufgeben (Sabine Kemper: ZDF-dokumentation "Abkassiert und totgepflegt", 1998/11,"Geldmaschine Pflegeheim", 1999/11/09). Hier geht der schlanke und bürokratisch wegsehende Staat - auch in "christlich-sozial" regierten Bundesländern - bereits jetzt schon über Leichen. Und trotzdem wird behauptet, daß der Staat zuviel kontrolliere. Wer Eigenverantwortung fordert,
muß die dazu erforderliche Selbstbestimmung sicherstellen.]
Wir brauchen gezielte Maßnahmen für die, die am meisten von Marginalisierung und sozialer Ausgrenzung bedroht sind.
- Die Kriminalität ist ein zentrales politisches Thema für die moderne Sozialdemokraten: So verstehen wir Sicherheit auf den Straßen als ein Bürgerrecht.
- Und: Eine Politik für lebenswerte Städte fördert Gemeinsinn, schafft Arbeit und macht die Wohnviertel sicherer.
All dies erfordert auch einen modernen Ansatz [?] des Regierens.
- Der Staat soll nicht rudern, sondern steuern, weniger kontrollieren als herausfordern. Problemlösungen müssen vernetzt [Auch die sprachlichen Blähungen von Wirtschaft und Politik werden sich immer ähnlicher] werden.
[Hat Schröder von Blair nicht gelernt, was ein "Minister for Consumer Affairs" ist?
[Er hat inzwischen. Und was tut sich? Hat der Verbraucher angesichts geschaffener irreversibler Tatsachen bald noch die Wahl, genetisch unmanipuliertes Gemüse zu kaufen?]
Wie sehr Freiheit und Kontrolle zueinander gehören, sehen wir aber auch ohne einen solchen Minister am (natürlich auch nicht perfekten) Beispiel der USA. Schnell hört bei uns das "vernetzte" Denken auf, wenn die USA als Beispiel für Deutschland angeführt werden. Auch in den USA gehören zu vielen gepriesenen Rechten oft leidige Pflichten, die unsere Eigentlichverantwortlichkeit predigenden Unternehmer nun überhaupt nicht mögen. Denn gerade kontrollieren können die Bürger (der Staat) die Wirtschaft mit vergleichsweise niedrigen Kosten. Kontrolle ist vorbeugend nötig, denn der freie Markt reguliert evolutionär oft erst, wenn individueller Schaden bereits entstanden ist und nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Beispiele für unumkehrbares "schädliches Marktversagen":
- Lebensmittelsicherheit, Gentechnik (Terminator Technologie als Beispiel, mit welchen Mitteln die freie und unbehinderte Wirtschaft den Markt unter Kontrolle bekommen möchte);
- Sicherheit technischer Einrichtungen (Beispiel: Bahnunglücke in Deutschland und England als Folge von Einsparungen);
- Exportkredite, Bankenaufsicht;
- Umweltschutz;
- Mängel bei Dienstleistungen für Behinderte, Patienten und Senioren, die "aus biologischen Gründen" nicht viel Kraft und noch weniger Zeit haben, ihre Rechte selbstbestimmt durchzusetzen.
Die unsichtbare Hand versagt, wenn sie Tote wiedererwecken soll. Wenn die Bürger staatliche Kontrolle (die sie natürlich selbst wiederum unter demokratischer Kontrolle halten müssen) aufgeben, dann verzichten sie auf bezahlbare Macht.
Der Staat muß nicht rudern und braucht nichteinmal viel zu steuern. Aber er kann ausgezeichnet für Transparenz sorgen, zum Beispiel durch Forschung, Bildung, Normung, Statistik, Qualitätskontrolle, Berechnungsvorschriften usw. Er muß schlicht und einfach die Fähigkeiten und Instrumente seiner Bürger stärken, den Markt zu durchschauen.
Das Gegenteil geschah jedoch, sogar absichtlich: Ein Beispiel für die staatliche Behinderung konsumentenfreundlicher Transparenz war die Berechnung von Effektivzinsen im Interesse der Banken. Dieser bekannten, aus der Zusammenarbeit von Ministerien und Banken hervorgegangenen, gründlich dokumentierten (von Capital 2/1985, "Blinde Kuh", S.34-35 bis zu DIE ZEIT, 1998/07/02, "Arrest für
Adam Riese", S.29) und mithin also bewußt gewollten Schlamperei setzte erst die EU ein Ende.
Jedoch nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Politik ist nicht weniger Kontrolle, sondern mehr Transparenz nötig. Bei uns dagegen wehrten sich im politischen Bereich CDU/CSU und FDP gegen einen Verteilungsbericht, wie er zum Beispiel in den USA üblich ist. Die SPD protestierte dagegen. Erinnert sie sich noch daran?]
- Innerhalb des öffentlichen Sektors muß es darum gehen, Bürokratie auf allen Ebenen abzubauen, Leistungsziele zu formulieren, die Qualität öffentlicher Dienste rigoros zu überwachen und schlechte Leistungen auszumerzen. [Schönes Beispiel für populistisches Gewäsch.]
- Moderne Sozialdemokraten [gehen den Weg des geringsten Widerstandes und] lösen Probleme, wo sie sich am besten lösen lassen. Einige Probleme lassen sich jetzt nur noch auf europäischer Ebene lösen. Andere, wie die jüngsten Finanzkrisen, erfordern eine stärkere internationale Zusammenarbeit. Im Grundsatz sollte jedoch gelten, daß Machtbefugnisse [?] an die niedrigstmögliche Ebene delegiert werden.
Wenn die neue Politik gelingen soll, muß sie eine Aufbruchstimmung und einen neuen Unternehmergeist auf allen Ebenen der Gesellschaft fördern. Dies erfordert:
- kompetente und gut ausgebildete Arbeitnehmer, die willens und bereit sind, neue Verantwortung zu übernehmen [die ihnen allerdings nur zusammen mit den entsprechenden "Machtbefugnissen" übertragen werden kann].
- Ein Sozialsystem, das Initiative und Kreativität fördert und neue Spielräume öffnet;
- Ein positives Klima für unternehmerische Selbständigkeit und Initiative. Kleine Unternehmen [zum Beispiel B-Läden?] müssen leichter zu gründen sein und überlebensfähiger werden;
- Wir wollen eine Gesellschaft, die erfolgreiche Unternehmer ebenso positiv bestätigt wie erfolgreiche Künstler und Fußballspieler und die Kreativität in allen Lebensbereichen zu schätzen weiß.
Unsere Staaten haben unterschiedliche Traditionen im Umgang zwischen Staat, Industrie, Gewerkschaften und gesellschaftlichen Gruppen, aber wir alle teilen die Überzeugung, daß die traditionellen Konflikte am Arbeitsplatz überwunden werden müssen.
Dazu gehört vor allem, die Bereitschaft und die Fähigkeit der Gesellschaft zum Dialog und zum Konsens wieder neu zu gewinnen und zu stärken. Wir wollen allen Gruppen ein Angebot unterbreiten, sich in die gemeinsame Verantwortung für das Gemeinwohl einzubringen.
In Deutschland hat die neue sozialdemokratische Regierung deshalb sofort nach Amtsantritt Spitzenvertreter von Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften zu einem Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit um einen Tisch versammelt.
- Wir möchten wirkliche Partnerschaft bei der Arbeit, indem die Beschäftigten die Chance erhalten, die Früchte des Erfolgs mit den Unternehmern zu teilen.
- Wir wollen, daß die Gewerkschaften in der Modernen Welt verankert bleiben. Wir wollen, daß sie den einzelnen gegen Willkür schützen und in Kooperation mit den Arbeitgebern den Wandel gestalten und dauerhaften Wohlstand schaffen helfen.
- In Europa streben wir - unter dem Dach eines Europäischen Beschäftigungspaktes - einen fortlaufenden Dialog mit den Sozialpartnern an. Das befördert den notwendigen ökonomischen Wandel.
III.
Eine neue angebotsorientierte Agenda für die Linke
Europa sieht sich der Aufgabe gegenüber, den Herausforderungen der Weltwirtschaft zu begegnen und gleichzeitig den sozialen Zusammenhalt angesichts tatsächlicher oder subjektiv empfundener Ungewißheit zu wahren. Eine Zunahme der Beschäftigung und der Beschäftigungschancen ist die beste Garantie für eine in sich gefestigte Gesellschaft.
Die beiden vergangenen Jahrzehnte des neoliberalen Laisser-faire sind vorüber. An ihre Stelle darf jedoch keine Renaissance des "deficit spending" und massiver staatlicher Intervention im Stile der siebziger Jahre treten. Eine solche Politik führt heute in die falsche Richtung.
Unsere Volkswirtschaften und die globalen Wirtschaftsbeziehungen haben einen radikalen Wandel erfahren. Neue Bedingungen und neue Realitäten erfordern eine Neubewertung alter Vorstellungen und die Entwicklung neuer Konzepte.
In einem großen Teil Europas ist die Arbeitslosigkeit viel zu hoch, und ein großer Teil dieser Arbeitslosigkeit ist strukturell bedingt. Um dieser Herausforderung begegnen zu können, müssen die europäischen Sozialdemokraten gemeinsam eine neue angebotsorientierte Agenda für die Linke formulieren und umsetzen.
Wir wollen den Sozialstaat modernisieren, nicht abschaffen. Wir wollen neue Wege der Solidarität und der Verantwortung für andere beschreiten, ohne die Motive für wirtschaftliche Aktivitäten auf puren Eigennutz zu gründen.
Die wichtigsten Elemente dieses Ansatzes sind die folgenden:
Ein robuster und wettbewerbsfähiger marktwirtschaftlicher Rahmen
Wettbewerb auf den Produktmärkten und offener Handel sind von wesentlicher Bedeutung für die Stimulierung von Produktivität und Wachstum. [Wie ist es um die geistige Flexibilität von Blair und Schröder selbst bestellt? Wie sehr Schöders und Blairs "Modernität" im Grunde noch an gestrigen Dogmen verhaftet ist, zeigt der Vergleich zu einem Buch, das von Rupert Riedl und Manuela Delpos herausgegeben wurde: Die Ursachen des Wachstums (Unsere Chancen zur Umkehr), Wien 1996, ISBN 3-218-00628-7. Weiterhin: D.L.Meadows, SZ 1999/11/13] Aus diesem Grund sind Rahmenbedingungen, unter denen ein einwandfreies Spiel der Marktkräfte möglich ist, entscheidend für wirtschaftlichen Erfolg und eine Vorbedingung für eine erfolgreichere Beschäftigungspolitik.

- Die EU sollte auch weiterhin als entschiedene Kraft für die Liberalisierung des Welthandels eintreten.
[Derweil arbeitet der Welthandel gegen eine wirkliche Liberalisierung. Beispiel:
Die Digital Versatile Disk (DVD) mit einem "Regional Code". Damit soll die Abspielbarkeit dieser Bild- und Tonträger regional begrenzt werden.
Zur Nutzung der Globalisierung pflegt die Angebotsseite nämlich gerne die Regionalisierung.
Wenn die SPD ernstaft für die Liberalisierung des Welthandels eintreten will, dann muß sie Hersteller und Vertreiber von DVD-Abspielgeräten und DVD-Laufwerken (für PCs), die den Regional Code nicht auswerten, wenigstens in Deutschland vor
Lizenzbestimmungen schützen, die die Wahlfreiheit der Konsumenten einschränken.
(Regional Coding schützt nicht(!) vor Raubkopierern.)
Mit einem solchen Schutz wird die Forderung nach Marktfreiheit glaubwürdig. Aber wahrscheinlich verstehen deutsche Politiker das Problem überhaupt nicht.
(Siehe auch OpenDVD.org sowie die Erläuterungen des ORF und des Vereins der Internet-Benutzer Österreichs.)]
- Die EU sollte auf den Errungenschaften des Binnenmarktes aufbauen, um wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu stärken, die das Produktivitätswachstum fördern.
Eine auf die Förderung nachhaltigen Wachstums
[Hartmut Bossel (IISD):
Indicators for Sustainable Development (Theory, Method, Applications), 1999, ISBN 1-895536-13-8] ausgerichtete Steuerpolitik
In der Vergangenheit wurden Sozialdemokraten mit hohen Steuern, insbesondere Unternehmenssteuern, identifiziert. Moderne Sozialdemokraten erkennen an, daß Steuerreformen und Steuersenkungen unter den richtigen Umständen wesentlich dazu beitragen können, ihre übergeordneten gesellschaftlichen Ziele zu verwirklichen.
So stärken Körperschaftssteuersenkungen die Rentabilität und schaffen Investitionsanreize. Höhere Investitionen wiederum erweitern die Wirtschaftstätigkeit und verstärken das Produktivpotential. Dies trägt zu einem positiven Dominoeffekt bei, durch den Wachstum die Ressourcen vermehrt, die für öffentliche Ausgaben für soziale Zwecke zur Verfügung stehen.
["Die Vermögensverteilung in Deutschland weist eine beträchtliche Disparität auf. Tendenziell nimmt diese seit geraumer Zeit zu, wie ein Vergleich der EVS-Daten von 1973, 1978, 1983 und 1988 zeigt. (Die Ergebnisse der EVS von 1993 sind mit früheren EVS-Daten nur eingeschränkt vergleichbar). Die Reichen sind reicher geworden, weil sie ihr Geldvermögen durch ansehnliche Vermögenserträge aufstocken konnten. Doch auch die unterschiedliche Entwicklung der funktionellen Einkommen hat zur Zunahme der Disparität in der Vermögensverteilung beigetragen: 1996 waren die entnommenen Gewinne und Vermögenseinkommen mehr als dreimal, die Nettolohn- und -gehaltsumme aber nur doppelt so hoch wie 1980." DIW, 1998]
- Die Unternehmensbesteuerung sollte vereinfacht, und die Körperschaftssteuersätze sollten gesenkt werden, wie dies New Labour im Vereinigten Königreich getan hat und wie es die Bundesregierung plant.
- Um sicherzustellen, daß Arbeit sich lohnt, und um die Fairness des Steuersystems zu stärken, sollten Familien und Arbeitnehmer entlastet werden, wie dies in Deutschland (mit dem Steuerentlastungsgesetz) begonnen wurde - und mit der Einführung niedrigerer Eingangssteuersätze und dem Steuerkredit für arbeitende Familien in Großbritannien.
- Investitionsneigung und Investitionskraft der Unternehmen - insbesondere des Mittelstandes - sollten gestärkt werden, wie dies die sozialdemokratisch geführte Bundesregierung in Deutschland mit der Unternehmenssteuerreform beabsichtigt, und wie es die Reform der Kapitaleinkünfte und der Unternehmenssteuern in Großbritannien zeigt.
- Die Steuerbelastung von harter Arbeit und Unternehmertum sollte reduziert werden. Die Steuerbelastung insgesamt sollte neu ausbalanciert werden, zum Beispiel zu Lasten des Umweltverbrauchs.
[Gemeint ist wohl, daß "Umweltverbrauch" vermehrt besteuert wird. (Ein System "verbraucht" seine Umwelt dadurch, daß es Entropie in seine Umwelt exportiert.)]
Deutschland, Großbritannien und andere sozialdemokratisch regierte Länder Europas gehen auf diesem Weg voran.
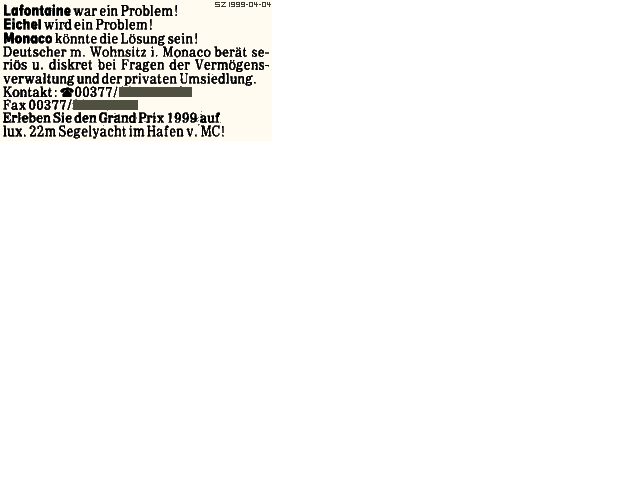
- Auf EU-Ebene sollte die Steuerpolitik energische Maßnahmen zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs und der Steuerflucht unterstützen. Dies erfordert bessere Zusammenarbeit, nicht Uniformität. Wir werden keine Maßnahmen unterstützen, die zu einer höheren Steuerlast führen und die Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätze in der EU gefährden.
Angebots- und Nachfragepolitik gehören zusammen und sind keine Alternativen
In der Vergangenheit haben Sozialdemokraten oft den Eindruck erweckt, Wachstum und eine hohe Beschäftigungsquote ließen sich durch eine erfolgreiche Steuerung der Nachfrage allein erreichen. Moderne Sozialdemokraten erkennen an, daß eine angebotsorientierte Politik eine zentrale und komplementäre Rolle zu spielen hat.
In der heutigen Welt haben die meisten wirtschaftspolitischen Entscheidungen Auswirkungen sowohl auf Angebot als auch auf Nachfrage.
- Erfolgreiche Programme, die von der Sozialhilfe in die Beschäftigung führen, steigern das Einkommen der zuvor Beschäftigungslosen und verbessern das den Arbeitgebern zur Verfügung stehende Arbeitskräfteangebot.
- Moderne Wirtschaftspolitik strebt an, die Nettoeinkommen der Beschäftigten zu erhöhen und zugleich die Kosten der Arbeit für die Arbeitgeber zu senken.
[Dieses Wunder "moderner Wirtschaftspolitik" wird im Rahmen praktisch angewandten Newspeaks durch die Umwandlung von "Lohnnebenkosten" in "eigenverantwortliche Vorsorge" bewirkt.]
Deshalb hat die Senkung der gesetzlichen Lohnnebenkosten durch strukturelle Reformen der sozialen Sicherungssysteme und eine zukunftsorientierte, beschäftigungsfreundliche Steuer- und Abgabenstruktur besondere Bedeutung. [Senkung der Lohnnebenkosten ist Senkung Ihres Lohns. Das macht Sie zum Einzel-Verhandlungspartner, herausgeteilt und beherrschbarer. Die vergessene Alternative zur Senkung demokratisch bestimmter Lohnnebenkosten: Verbesserung der öffentlichen Kontrolle ihrer Verwendung.]
Ziel sozialdemokratischer Politik ist es, den Scheinwiderspruch von Angebots- und Nachfragepolitik zugunsten eines fruchtbaren Miteinanders von mikroökonomischer Flexibilität und makroökonomischer Stabilität zu überwinden.
Um in der heutigen Welt ein größeres Wachstum [hier hört modernes Denken leider auf] und mehr Arbeitsplätze zu erreichen, müssen Volkswirtschaften anpassungsfähig sein: Flexible Märkte sind ein modernes sozialdemokratisches Ziel.
Makroökonomische Politik verfolgt noch immer einen wesentlichen Zweck: Sie will den Rahmen für stabiles Wachstum schaffen und extreme Konjunkturschwankungen vermeiden. Sozialdemokraten müssen aber erkennen, daß die Schaffung der richtigen makroökonomischen Bedingungen nicht ausreicht, um Wachstum zu stimulieren und mehr Arbeitsplätze zu schaffen.
Veränderungen der Zinssätze oder der Steuerpolitik führen nicht zu verstärkter Investitionstätigkeit und zu mehr Beschäftigung, wenn nicht gleichzeitig die Angebotsseite der Wirtschaft anpassungsfähig genug ist, um zu reagieren. Um die europäische Wirtschaft dynamischer zu gestalten, müssen wir sie auch flexibler machen.
- Unternehmen müssen genügend Spielraum haben, um sich die verbesserten Wirtschaftsbedingungen zunutze zu machen und neue Chancen zu ergreifen: Sie dürfen nicht durch Regulierungen und Paragraphen erstickt werden.
[Ich empfehle Schröder und Blair, sich hier mit amerikanischem Recht ganzheitlich vertraut zu machen.]
- Die Produkt-, Kapital- und Arbeitsmärkte müssen allesamt flexibel sein: Wir dürfen nicht Rigidität in einem Teil des Wirtschaftssystems mit Offenheit und Dynamik in einem anderen verbinden.
Anpassungsfähigkeit und Flexibilität stehen in der wissensgestützten Dienstleistungsgesellschaft in Zukunft immer höher im Kurs
Unsere Volkswirtschaften befinden sich im Übergang von der industriellen Produktion zur wissensorientierten Dienstleistungsgesellschaft der Zukunft. Sozialdemokraten müssen die Chance ergreifen, die dieser wirtschaftlicher Umbruch mit sich bringt. Sie bietet Europa die Gelegenheit, zu den Vereinigten Staaten aufzuschließen. Sie eröffnet Millionen Menschen die Chance, neue Arbeitsplätze zu finden, neue Fähigkeiten zu erlernen, neue Berufe zu ergreifen, neue Unternehmen zu gründen und zu erweitern - kurzum, ihre Hoffnung auf eine bessere Zukunft zu verwirklichen.
Sozialdemokraten müssen aber auch anerkennen, daß sich die Grundvoraussetzungen für wirtschaftlichen Erfolg verändert haben.
Dienstleistungen kann man nicht auf Lager halten: Der Kunde nutzt sie, wie und wann er sie braucht - zu unterschiedlichen Tageszeiten, auch außerhalb der heute als üblich geltenden Arbeitszeit. Das rasche Vordringen des Informationszeitalters, insbesondere das enorme Potential des elektronischen Handels, verspricht, die Art, wie wir einkaufen, lernen, miteinander kommunizieren und uns entspannen, radikal zu verändern. Rigidität und Überregulierung sind ein Bremsklotz für die wissensorientierte Dienstleistungsgesellschaft der Zukunft. Sie ersticken das Innovationspotential, das zur Schaffung neuen Wachstums und neuer Arbeitsplätze erforderlich ist. Wir brauchen nicht weniger, sondern mehr Flexibilität.
Ein aktiver Staat in einer neuverstandenen Rolle hat einen zentralen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung zu leisten
Moderne Sozialdemokraten sind keine Laisser-faire-Neoliberalen.
[Neoliberalismus ist die Zerstörung der Demokratie: "Was ist der Neoliberalismus? Ein Programm zur Zerstörung
kollektiver Strukturen, die noch in der Lage sind, der Logik des
reinen Marktes zu widerstehen." (Pierre Bourdieu)]
Flexible Märkte müssen mit einer neu definierten Rolle für einen aktiven Staat kombiniert werden. Erste Priorität muß die Investition in menschliches und soziales Kapital sein.
Wenn auf Dauer ein hoher Beschäftigungsstand erreicht werden soll, müssen Arbeitnehmer auf sich verändernde Anforderungen reagieren. Unsere Volkswirtschaften leiden an einer erheblichen Diskrepanz zwischen offenen Stellen, die nicht besetzt werden können (z.B. im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie), und (dem Mangel an) angemessen qualifizierten Bewerbern.
Dies bedeutet, daß Bildung keine "einmalige" Chance sein darf: Zugang und Nutzung zu Bildungsmöglichkeiten und lebenslanges Lernen stellen die wichtigste Form der Sicherheit in der modernen Welt dar. Die Regierungen sind deshalb dafür verantwortlich, einen Rahmen zu schaffen, der es den einzelnen ermöglicht, ihre Qualifikationen zu steigern und ihre Fähigkeiten auszuschöpfen. Dies muß heute für Sozialdemokraten höchste Priorität haben.
- Die Ausbildungsqualität auf allen Ebenen der schulischen Bildung und für jede Art von Begabung muß gesteigert werden: Wo Probleme bei Lesen, Schreiben und Rechnen bestehen, müssen diese behoben werden, da wir ansonsten Menschen zu einem Leben mit niedrigem Einkommen, Unsicherheit und Arbeitslosigkeit verurteilen.
- Wir wollen, daß jeder Jugendliche die Chance erhält, sich über eine qualifizierte Berufsausbildung den Weg in die Arbeitswelt zu bahnen. Im Dialog mit den Arbeitgebern, den Gewerkschaften und anderen müssen wir sicherstellen, daß Bildungschancen und eine ausreichende Zahl von Ausbildungsplätzen zur Verfügung gestellt und die Bedürfnisse der lokalen Arbeitsmärkte gedeckt werden.
In Deutschland unterstützt die Politik dieses Vorhaben mit einem Sofortprogramm für Arbeit und Ausbildung, das 100.000 Jugendlichen einen neuen Job, eine Lehrstelle oder eine Qualifizierung vermittelt. In Großbritannien hat das "welfare to work"-Programm es bereits 95.000 Jugendlichen ermöglicht, Arbeits- und Ausbildungsplätze zu finden.
- Wir müssen die nachschulische Ausbildung reformieren und ihre Qualität heben und gleichzeitig Bildungs- und Ausbildungsprogramme modernisieren, um Anpassungs- und Beschäftigungsfähigkeit im späteren Leben zu fördern.
[Wie weit ist die Anpassung Schröders gegangen? Politische Bildung ist für Schröder und Blair wohl nicht interessant genug, hier erwähnt zu werden. (Vielleicht ist eine Volksverblödung sogar beabsichtigt, zu der kein Geringerer als Immanuel Kant ein Verdummungsgebot formulierte.) Besonders wichtig finde ich übrigens eine wissenschaftliche Bildung, deren Ziel nicht nur marktgerechte Anwendbarkeit, sondern insbesondere die Ausweitung der Urteilskraft der Lernenden ist.
(Siehe auch H.v.Hentig: Die Menschen stärken, die Sachen klären. Ein Plädoyer für die Wiederherstellung der Aufklärung, Stuttgart 1985; und Rudolf Egger: Globalisierung, Flexibilisierung und Bildung, ZEBRATL 99/2.)]
Dem Staat kommt die besondere Aufgabe zu, Anreize zur Bildung von Sparkapital zu setzen, um die Kosten des lebenslangen Lernens bestreiten zu können.
[bye bye, Chancengleicheit]
Auch soll ein breiterer Bildungszugang durch die Förderung des Fernunterrichts geschaffen werden.
- Wir sollten sicherstellen, daß die Ausbildung eine wesentliche Rolle in unseren aktiven Arbeitsmarktpolitiken für Arbeitslose und die von Arbeitslosigkeit betroffenen Haushalte spielt.
Eine moderne und effiziente öffentliche Infrastruktur einschließlich einer starken Wissenschaftsbasis ist ein wesentliches Merkmal einer dynamischen arbeitsplätzeschaffenden Wirtschaft. Es ist wichtig sicherzustellen, daß sich die öffentlichen Ausgaben in ihrer Zusammensetzung auf diejenigen Tätigkeiten konzentrieren, die dem Wachstum und der Förderung des notwendigen Strukturwandels am besten dienen. [Für mich ist hier der dümmste und gefährlichste Abschnitt in dem ganzen Blair/Schröder-Papier. Wissenschaft konzentriert sich nicht darauf, vorgegebene Erkenntnisse zu
bestätigen, sondern hat Wissen zu schaffen. Damit erkennen wir Ziele und die Wege zu diesen Zielen - aber auch Irrwege. Je wertfreier Wissenschaft ist, desto besser hilft sie uns, Werte zu finden. Der Versuch, Wissenschaft zu zähmen (und ihr zum Beispiel Wachstum als von ihr zu unterstützendes Ziel vorzuschreiben), modernisiert nicht die Sozialdemokratie, sondern wirft sie wieder in ihre sozialistischen Ursprünge zurück.
Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei.
Wissenschaft darf nicht darauf beschränkt werden, nach Zielvorgabe nur irgendeinem als irgendwie notwendig vorgegebenen Strukturwandel und Wachstum gefällig zuzuarbeiten. Es kann nicht nur darum gehen, daß wir dem Strukturwandel wie Lemminge nachhetzen und Wachstum nach Art dieser Nager bis zum Sprung über die Klippe vorantreiben. Sondern Wissenschaft muß die Menschen befähigen, die Notwendigkeit von Strukturwandel und Wachstum selbst mit Hilfe einer die individuelle Urteilskraft stärkenden Wissenschaftsbasis überprüfen und die Richtung des Wandels mitbestimmen zu können. Es geht um die wissensbasierte und demokratische (also nicht nur marktgesteuerte) Gestaltung der Strukturen, in und mit denen wir leben.
"Ich denke, daß sich die nationale und internationale Technokratie
nicht wirksam bekämpfen läßt, solange man sich ihr nicht
auf dem von ihr vorgezogenen Terrain entgegenstellt, dem der Wissenschaft,
besonders dem der Ökonomie. Um dem abstrakten und verstümmelten
Wissen zu entgegnen, dessen sich die Technokraten rühmen, wird ein Wissen
benötigt, daß die Menschen und die Realitäten, denen sie ausgesetzt
sind, mehr respektiert." (Aus einer Rede von Pierre
Bourdieu, Paris, Gare de Lyon, 1995/12/12;
Quelle: Libération et L'Humanité 1995/12/14)]
Moderne Sozialdemokraten müssen die Anwälte des Mittelstands sein
Der Aufbau eines prosperierenden Mittelstands muß eine wichtige Priorität für moderne Sozialdemokraten sein. Hier liegt das größte Potential für neues Wachstum und neue Arbeitsplätze in der wissensgestützten Gesellschaft der Zukunft.
[Als Regierungspartei haben die Sozialdemokraten die Anwälte des gesamten Volkes zu sein.]
- Menschen unterschiedlichster Herkunft wollen sich selbständig machen: Seit langem etablierte und neue Unternehmer, Anwälte, Computerexperten, Ärzte, Handwerker, Unternehmensberater, Kulturschaffende und Sportler. Ihnen muß man den Spielraum lassen, wirtschaftliche Initiative zu entwickeln und neue Geschäftsideen zu kreieren. Sie müssen zur Risikobereitschaft ermutigt werden. Gleichzeitig muß man ihre Belastungen verringern. Ihre Märkte und ihr Ehrgeiz dürfen nicht durch Grenzen behindert werden.
- Europas Kapitalmärkte sollten geöffnet werden, damit Unternehmen und Unternehmer leichten Zugang zu Finanzierungsquellen erhalten. Wir wollen gemeinsam daran arbeiten, sicherzustellen daß High-Tech-Firmen im Wachstum denselben Zugang zu den Kapitalmärkten erhalten wie ihre Konkurrenten.
- Wir sollten es dem einzelnen leicht machen, Unternehmen zu gründen, und neuen Firmengründungen sollten wir Wege bahnen, indem wir Kleinunternehmen von administrativen Belastungen befreien und ihren Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten erweitern. Wir sollten es Kleinunternehmen im besonderen erleichtern, neues Personal einzustellen: Dies bedeutet, die Regulierungslast zu verringern und die Lohnnebenkosten zu senken.
- Die Verbindungen zwischen Wirtschaft und Wissenschaft sollten gestärkt werden, um mehr unternehmerische Nebeneffekte ("spin offs") aus der Forschung und die Förderung der Konzentration ("clusters") neuer High-Tech-Industrien zu gewährleisten.
Gesunde öffentliche Finanzen sollten zum Gegenstand des Stolzes für Sozialdemokraten werden
In der Vergangenheit wurde sozialdemokratische Politik allzu oft assoziiert mit der Einstellung, daß der beste Weg zur Förderung von Beschäftigung und Wachstum die Ausdehnung der öffentlichen Verschuldung zum Zweck höherer öffentlicher Ausgaben sei. Für uns ist öffentliche Verschuldung nicht generell abzulehnen - während eines zyklischen Abschwungs kann es Sinn machen, die automatischen Stabilisatoren arbeiten zu lassen. Und Verschuldung mit dem Ziel höherer öffentlicher Investitionen, in strikter Beachtung der "goldenen Regel", kann eine wichtige Rolle in der Stärkung der Angebotsseite der Ökonomie spielen.
Aber "Defizit Spending" kann nicht genutzt werden, um strukturelle Schwächen in der Ökonomie zu beseitigen, die schnelleres Wachstum und höhere Beschäftigung verhindern. Sozialdemokraten dürfen deshalb exzessive Staatsverschuldung nicht tolerieren. Wachsende Verschuldung stellt eine unfaire Belastung kommender Generationen dar. Sie kann unwillkommene Verteilungseffekte haben. Und schließlich ist Geld, das zum Schuldendienst eingesetzt werden muß, nicht mehr für andere Prioritäten verfügbar, einschließlich höherer Investitionen in Bildung, Ausbildung und Infrastruktur.
IV.
[Wachstum für wen?
- MÜNCHEN (dpa, 2000/06/29). Nicht nur die Börsenkurse der im Deutschen
Aktienindex (Dax) notierten Konzerne sind in den vergangenen Jahren in die
Höhe geschossen, sondern auch die Einkommen ihrer Vorstandsmitglieder. Die
Manager der 30 bedeutendsten Unternehmen auf dem hiesigen Kurszettel verdienten
im vergangenen Jahr durchschnittlich 2,5 Millionen Mark, hat die
Personalberatung Spencer Stuart ermittelt. Im Vergleich mit 1997 bedeutet dies
ein Plus um 40 Prozent
[d.h. etwa 18 Prozent pro Jahr].
Wie Agentur-Chef Otto Werner Obermaier berichtet,
lägen die Managergehälter bei den Branchenriesen zwar weit
auseinander. Kaum ein Vorstand verdiene aber weniger als eine Million Mark.
- hih BERLIN (FR, 2000/06/29).
Den Arbeitnehmern und Gewerkschaften ist es in den neunziger
Jahren nicht gelungen, eine "gerechte Teilhabe" am Wirtschaftswachstum
zu sichern. Das ist der Tenor eines Berichts des DGB zur
"Einkommensentwicklung in Deutschland". [...]
Die Bruttoentgelte seien
seither nur um rund 20 Prozent [d.h. unter 1 Prozent pro Jahr] gestiegen. Dieser ohnehin "geringe
Zuwachs" wurde zum größten Teil durch "zunehmende Steuer- und
Sozialversicherungslasten" der Arbeitnehmer aufgefressen - mit der Folge,
dass die realen Nettolöhne in den zwei Dekaden nicht einmal um fünf
Prozent [d.h. etwa 0,2 Prozent pro Jahr]
zugelegt haben. Diesem mageren Zugewinn bei der Kaufkraft der
Arbeitnehmer steht ein massives Wachstum der realen Nettogewinne um gut 84 Prozent
[d.h. etwas über 3 Prozent pro Jahr]
gegenüber. [...]
Doch die Unternehmen nutzten die höheren Erträge kaum zum
Aus- und Aufbau neuer Kapazitäten und damit zur Schaffung von
Arbeitsplätzen. Die selbst erwirtschafteten Mittel übertrafen 1999
die Investitionen um 28 Prozent. Anfang der neunziger Jahre war das
Verhältnis noch ausgeglichen.
Link: Ungleichverteilung]
|
Eine aktive Arbeitsmarktpolitik für die Linke
Der Staat muß die Beschäftigung aktiv fördern und nicht nur passiver Versorger der Opfer wirtschaftlichen Versagens sein.
Menschen, die nie gearbeitet haben oder schon lange arbeitslos sind, verlieren die Fertigkeiten, die sie brauchen, um auf dem Arbeitsmarkt konkurrieren zu können. Langzeitarbeitslosigkeit beeinträchtigt die persönlichen Lebenschancen auch in anderer Weise und macht die uneingeschränkte gesellschaftliche Teilhabe schwieriger.
Ein Sozialversicherungssystem, das die Fähigkeit, Arbeit zu finden, behindert, muß reformiert werden. Moderne Sozialdemokraten wollen das Sicherheitsnetz aus Ansprüchen in ein Sprungbrett in die Eigenverantwortung umwandeln.
Für unsere Gesellschaften besteht der Imperativ der sozialen Gerechtigkeit aus mehr als der Verteilung von Geld. Unser Ziel ist eine Ausweitung der Chancengleichheit, unabhängig von Geschlecht, Rasse, Alter oder Behinderung - um sozialen Ausschluß zu bekämpfen und die Gleichheit zwischen Mann und Frau sicherzustellen.
Die Menschen verlangen zu Recht nach hochwertigen Dienstleistungen und Solidarität für alle, die Hilfe brauchen - aber auch nach Fairneß gegenüber denen, die das bezahlen. Alle sozialpolitischen Instrumente müssen Lebenschancen verbessern, Selbsthilfe anregen, Eigenverantwortung fördern.
Mit diesem Ziel wird in Deutschland das Gesundheitssystem ebenso wie das System der Alterssicherung umfassend modernisiert, indem beide auf die Veränderungen in der Lebenserwartung und die sich verändernden Erwerbsbiographien eingestellt werden, ohne den Grundsatz der Solidarität dabei preiszugeben. Derselbe Gedanke stand im Hintergrund bei der Einführung der "Stakeholder Pensions" und der Reform der Erwerbsunfähigkeitszahlungen in Großbritannien.
Zeiten der Arbeitslosigkeit müssen in einer Wirtschaft, in der es den lebenslangen Arbeitsplatz nicht mehr gibt, eine Chance für Qualifizierung und persönliche Weiterbildung sein. Teilzeitarbeit und geringfügige Arbeit sind besser als gar keine Arbeit, denn sie erleichtern den Übergang von Arbeitslosigkeit in Beschäftigung.
Eine neue Politik mit dem Ziel, arbeitslosen Menschen Arbeitsplätze und Ausbildung anzubieten, ist eine sozialdemokratische Priorität - wir erwarten aber auch, daß jeder die ihm gebotenen Chancen annimmt.
Es reicht aber nicht, die Menschen mit den Fähigkeiten und Kenntnissen auszurüsten, die sie brauchen, um erwerbstätig zu werden. Das System der Steuern und Sozialleistungen muß sicherstellen, daß es im Interesse der Menschen liegt, zu arbeiten. Ein gestrafftes und modernisiertes Steuer- und Sozialleistungssystem ist eine wesentliche Komponente der aktiven, angebotsorientierten Arbeitsmarktpolitik der Linken. Wir müssen:
- dafür sorgen, daß sich Arbeit für den einzelnen und die Familie lohnt. Der größte Teil des Einkommens muß in den Taschen derer verbleiben, die dafür gearbeitet haben;
- Arbeitgeber durch den gezielten Einsatz von Subventionen für geringfügige Beschäftigung und die Verringerung der Steuer- und Sozialabgabenlast auf geringfügige Beschäftigungsverhältnisse ermutigen, "Einstiegsjobs" in den Arbeitsmarkt anzubieten. Wir müssen ausloten, wieviel Spielraum es gibt, die Belastung durch Lohnnebenkosten mit Hilfe von Umweltsteuern zu senken;
- gezielte Programme für Langzeitarbeitslose und andere Benachteiligte auflegen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich unter Beachtung des Grundsatzes, daß Rechte gleichzeitig auch Pflichten bedingen, wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren;
- alle Leistungsempfänger, darunter auch Menschen im arbeitsfähigen Alter, die Erwerbsunfähigkeitsleistungen beziehen, auf ihre Fähigkeit überprüfen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, und die staatlichen Stellen so reformieren, daß sie Arbeitsfähige dabei unterstützen, eine geeignete Beschäftigung zu finden.
- Unternehmergeist und Geschäftsgründungen als gangbaren Weg aus der Arbeitslosigkeit unterstützen. Solche Entscheidungen bringen erhebliche Risiken für diejenigen mit sich, die einen solchen Schritt wagen. Wir müssen diese Menschen unterstützen, indem wir diese Risiken kalkulierbar machen.
Die neue angebotsorientierte Agenda der Linken wird den Strukturwandel beschleunigen. Sie wird es aber auch leichter machen, mit ihm zu leben und ihn zu gestalten.
Anpassung an den Wandel ist nie einfach, und der Wandel scheint sich schneller zu vollziehen als je zuvor [Zu dieser Denkfalle gibt es ein interessantes Buch von Peter Kafka: Gegen den Untergang, 1994, ISBN 3-446-17834-1.], nicht zuletzt aufgrund der Auswirkungen neuer Technologien. Der Wandel vernichtet unweigerlich Arbeitsplätze, aber er schafft auch neue.
Zwischen dem Verlust von Arbeitsplätzen in einem Sektor und der Schaffung von neuen Arbeitsplätzen anderswo können jedoch zeitliche Lücken entstehen. Was immer der langfristige Nutzen für Volkswirtschaften und Lebensstandard sein mag, in einigen Wirtschaftszweigen und bei einigen Gruppen werden sich die Kosten vor dem Nutzen einstellen. Daher müssen wir unsere Bemühungen darauf konzentrieren, Probleme des Übergangs abzufedern. Die unerwünschten Auswirkungen des Wandels werden um so stärker ausfallen, je länger man sich diesem Wandel widersetzt, aber es wäre Wunschdenken, sie leugnen zu wollen.
Je reibungsloser der Arbeitsmarkt und die Produktmärkte funktionieren, desto leichter wird die Anpassung gelingen. Beschäftigungshindernisse in Sektoren mit relativ niedriger Produktivität müssen verringert werden, wenn Arbeitnehmer, die von den mit jedem Strukturwandel einhergehenden Produktivitätszuwächsen verdrängt wurden, anderswo Arbeit finden sollen. Der Arbeitsmarkt braucht einen Sektor mit niedrigen Löhnen, um gering Qualifizierten Arbeitsplätze verfügbar zu machen.
Die öffentliche Hand kann durch die gezielte Entlastung niedriger Einkommen von Sozialabgaben neue Erwerbschancen schaffen und so gleichzeitig Unterstützungsleistungen für Arbeitslose sparen. Reformierte Arbeitsmarktpolitiken müssen verdrängte Arbeitnehmer durch Umschulung, die gezielte Rückführung aus der sozialen Abhängigkeit in Erwerbstätigkeit sowie Maßnahmen, durch die sich Arbeit wieder lohnen soll, an diese neuen Beschäftigungsmöglichkeiten heranführen.
V.
"Politisches Benchmarking" in Europa
Die Herausforderung besteht in der Formulierung und Umsetzung einer neuen sozialdemokratischen Politik in Europa. Wir reden nicht einem einheitlichen europäischen Modell das Wort, geschweige denn der Umwandlung der Europäischen Union in einen "Superstaat". Wir sind für Europa und für Reformen in Europa.
Die Menschen unterstützen weitere Integrationsschritte, wenn damit ein wirklicher "Mehrwert" einhergeht und sie klar begründet werden können, wie der Kampf gegen Kriminalität und Umweltzerstörung sowie die Förderung gemeinsamer Ziele in der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik. Aber gleichzeitig bedarf Europa dringend der Reformen - effizientere und transparentere Institutionen, eine Reform veralteter Politiken und die energische Bekämpfung von Verschwendung und Betrug.
Wir stellen unsere Ideen als einen Entwurf vor, nicht als abgeschlossenes Programm. Die Politik der Neuen Mitte und des Dritten Weges ist bereits Realität, in vielen Kommunen, in reformierten nationalen Politiken, in der europäischen Kooperation und in neuen internationalen Initiativen.
Deshalb haben die deutsche und die britische Regierung beschlossen, den bestehenden Meinungsaustausch über die Entwicklung von Politik in einen umfassenderen Ansatz einzubetten. Wir schlagen vor, dies auf dreierlei Weise zu tun:
- es soll eine Reihe von Ministerbegegnungen geben, begleitet von häufigen Kontakten ihrer engsten Mitarbeiter.
- Zweitens werden wir die Diskussion mit den politischen Führungspersönlichkeiten anderer europäischer Staaten suchen, die mit uns - in ihrem jeweiligen innerstaatlichen Kontext - die Sozialdemokratie modernisieren wollen. Damit beginnen wir jetzt.
- Drittens werden wir ein Netzwerk von Fachleuten, Vor-Denkern, politischen Foren und Diskussionsrunden einrichten. So vertiefen wir das Konzept der Neuen Mitte und des Dritten Weges und entwickeln es ständig weiter. Das hat für uns Priorität.
Ziel dieser Erklärung ist es, einen Anstoß zur Modernisierung zu geben. Wir laden alle Sozialdemokraten in Europa dazu ein, diese historische Chance zur Erneuerung nicht verstreichen zu lassen. Die Vielfalt unserer Ideen ist unser größtes Kapital für die Zukunft. Unsere Gesellschaften erwarten, daß wir unsere vielfältigen Erfahrungen zu einem neuen Konzept bündeln.
Laßt uns zusammen am Erfolg der Sozialdemokratie für das neue Jahrhundert bauen. Laßt die Politik des Dritten Weges und der Neuen Mitte Europas neue Hoffnung sein.
|
[Nachtrag (G.Kluge, 1999/06/19):
Wohlstandsmüll:
Unwort des Jahres 1997, als Bezeichnung für Menschen erstmalig
verwendet von Helmut Maucher (damals noch Vollzeit-Chef von Nestlé)
in einem STERN-Interview mit dem Titel "Gentechnologie - dazu stehen wir"
(Hervorhebungen nachträglich eingefügt):
- STERN (Nr. 47 vom
14.11.1996, Seite 172): "Massiver Sozialabbau ist für Sie ein positives Signal?"
- MAUCHER: "Wir haben mittlerweile provozierend gesagt, einen gewissen Prozentsatz
an Wohlstandsmüll in unserer Gesellschaft. Leute, die entweder keinen
Antrieb haben zu arbeiten, halb krank oder müde sind, die das System einfach
ausnutzen. Daß Sie mich richtig verstehen: Ich bin der Meinung, daß wir
genügend Geld haben, diejenigen zu unterstützen die wirklich alt,
krank oder arbeitslos sind. Aber es gibt zuviel Mißbrauch und Auswüchse."
- STERN: Sechs Millionen Arbeitslose: alles Sozialschmarotzer?
- MAUCHER: Wir müssen in Kauf nehmen, daß wir einen Teil der Bevölkerung
durchfüttern, der wirklich nicht mehr fähig ist zu arbeiten. Wenn aber der
eine oder andere etwas stärker unter
Druck gesetzt würde, man ihm
schlechter bezahlte Jobs zumuten könnte oder die Differenz zwischen Nettolohn
und Sozialleistungen mehr als zehn Prozent betragen würde, würde er vielleicht
sagen: "Gut, dann nehme ich lieber wieder eine Schaufel in die Hand."
Damit sei ein "Gipfel in der zynischen Bewertung von Menschen nach ihrem
'Marktwert' erreicht", meinten
sechs Experten, die den Begriff aus knapp 1300
Vorschlägen auswählten. Das berichtete der Sprecher der Jury, der
Germanistik-Professor Schlosser (Frankfurt, 1998/01/20).
Ob dieser Gipfel tatsächlich
ereicht wurde, ergäbe der Vergleich mit der Sprache eines
Josef Goebbels. Siehe auch: Neurosen
und Lester Thurow.
"Ein solcher Mann weiß, was er sagt, er hat das politische und
gesellschaftliche Umfeld eiskalt analysiert.
Wenn er danach glauben darf, ungestraft in
derart zynischen Verbalradikalismus verfallen zu können,
ist dies der eigentliche Skandal",
kommentierten die Aachener Nachrichten. Helmut O. Maucher
repräsentiert das Denken des internationalen Handels, denn
er ist amtierender Präsident der internationalen Handelskammer
(ICC) und
außerdem Vorsitzender der Europarunde der Industrie (ERT),
die beste Kontakte zur Europäischen Kommission
unterhält (1998). Damit beantwortet sich die Frage, ob
Marktkräfte zur Kontrolle von Handel und Händlern
ausreichen.
Zum Abschluß noch ein Witz:
"Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen
ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt."]
|
[Literatur:
- Elmar Altvater / Rolf Hecker / Michael Heinrich: KAPITAL.DOC, 1999, ISBN 3-89691-437-5
- Dirk Baecker, Wetten als Stabilitätsfaktor, TAZ 1999/12/20
- Paul Bairoch: Mythes et paradoxes de l'histoire économique, Paris (La Découverte) 1995
- Dorothee Beck / Hartmut Meine: Wasserprediger und Weintrinker. Wie Reichtum vertuscht und Armut verdrängt wird, Göttingen 1997, ISBN 3-88243-527-5 (Besprechung in der TAZ)
- Hartmut Bossel (IISD):
Indicators for Sustainable Development (Theory, Method, Applications), 1999, ISBN 1-895536-13-8
- Bertolt Brecht: Dreigroschenroman, 1934, ISBN 3-518-39304-9 (Engl.: Threepenny Novel, ISBN 0-14-018037-0)
- Hermann Broch: Massenwahntheorie, 1939 bis 1948, ISBN 3-518-02504-X; insbes. 3. Teil, Kapitel 5.8 "Totalwirtschaft und Totalversklavung"
- Achim Brunnengräber: Über die Unzulänglichkeiten kosmopolitischer Demokratie in einer transnationalen Welt, 1999?, WWW
- Burkhard G. Busch: Entgleist und verspätet (Post, Bahn & Co. in der Privatisierung. Das Ende aller Ordnung.), 2000, ISBN 3-7844-7400-4
- Noam Chomsky: Secrets, Lies and Democracy, 1994, ISBN 1-878825-04-6 (für Leser, die von Amerika lernen wollen!)
- Noam Chomsky: The Common Good, 1998, ISBN 1-878825-08-9
- Christian v. Ditfurth: Wachstumswahn, 1995, ISBN 3-88977-418-0
- Klaus v. Dohnany: Gemeinsinn und Zivilcorage, Merkur 2000/11, ISBN 3-608-97019-3
- Denis Duclos: Naissance de l'hyperbourgeoisie, Le Monde Diplomatique 1998/08 (Die Internationale der Hyperbourgoisie: Eine neue Klasse löst die alten Führungsschichten ab.)
- Thomas Byrne Edsall: The Return of Inequality, Atlantic Monthly, June 1988
- Thomas Frank: One Market under God (extreme capitalism, market populism and the end of economic democracy),2000/2002, ISBN 0-099-42224-7
- Jean Gadrey: New Economy, New Myth, 2001/2003, ISBN 0-415-30142-4
- James K. Galbraith: Created Unequal, 1998, ISBN 0-684-84988-7
- Gasche/Guggenbühl/Vothlobel: Das Geschwätz von der freien Marktwirtschaft, 1997, ISBN 3-7064-0319-6 (Unter welchen Bedingungen schadet die freie Marktwirtschaft der freien Marktwirtschaft?), !!!
- Jeff Gates: The Ownership Solution (Towards a shared capitalism for the twenty-first century), 1998, ISBN 0-14-027530-4
- Christian Hein (WOCATE): Entropie - eine Zugangsgröße zur Herausbildung allgemeinen Technikverständnisses?, Halle 1997, (wenn wieder mal aus dem WWW genommen, hier die Mirror-File: ENTHEIN.ZIP)
- Alan Haworth: Anti-Libertarianism (Markets, Philosophy and Myth), 1994, ISBN 0-415-08254-4, !!!
- F.Hengsbach SJ / M.Möhring-Hesse: Aus der Schieflage heraus (Demokratische Verteilung von Reichtum und Arbeit), 1999, ISBN 3-8012-0278-X
- H.v.Hentig: Die Menschen stärken, die Sachen klären. Ein Plädoyer für die Wiederherstellung der Aufklärung, Stuttgart 1985, ISBN 3-15-008072-X, !!!
- Uwe Jean Heuser: Die neue Teilung, Wohlstand für wenige, DIE ZEIT 1997/10/24
- Ernst-Ulrich Huster (Hrsg.): Reichtum in Deutschland, Die Gewinner in der sozialen Polarisierung, Frankfurt 1997, erheblich erweiterte Neuauflage, ISBN 3-593-35859-X (Besprechung in der TAZ: Die erste Auflage von 1993 markierte den (Neu-)Beginn der akademischen Reichtumsdiskussion.) !!!
- Hartmut Köhler: Mathematics Teaching and Democratic Education, Stuttgart Institute for Education and Learning, D-70174 Stuttgart (empfohlen von Colin Hannaford, New Scientist 1999/08/28, S.46)
- David C. Korten, When Corporations Rule the World, 1995
- Oskar Lafontaine: Das Herz schlägt links, 1999, ISBN 3-430-15947-6
- Lutz Leisering / Stephan Leibfried: Time and Poverty in the Welfare State, 1999 (2000?)
(Übersetzte und dabei intensiv überarbeitete Ausgabe von "Zeit der
Armut", 1995) !!!
- Bernard Mandeville: The Fable of the Bees, London 1705, ISBN 0-14-044541-2; large edition (Liberty Fund, Indianapolis): ISBN 0-86597-072-6 (hardcover), ISBN 0-86597-075-0 (paperback); deutsch: Die Bienenfabel, ISBN 3-518-07900-X
- Hans-Peter Martia / Harald Schumann: Die Globalisierungsfalle (Der Angriff auf Demokratie und Wohlstand), 1996, ISBN 3-498-04381-1
- Dennis L. Meadows: Der Kaiser ist längst nackt (Für eine dauerhaft tragbare weitere Wirtschaftsentwicklung ist es zu spät. Um so mehr muss die Gesellschaft Abschied nehmen von einer Ideologie grenzenlosen Wachstums und Visionen entwickeln, wie sie mit dem Mangel umgehen wird.), 1999/11/13-14, Süddeutsche Zeitung
- Farhad Nili: Growth Constrained by Exhaustible Resources:A Creative Destruction Approach, 2000
- Christian Nürnberger: Die Machtwirtschaft, 1999, ISBN 3-423-24162-4
- Ricardo Petrella: Die Enteignung des Staates schreitet voran, Le Monde Diplomatique 1999/09
- Rupert Riedl / Manuela Delpos: Die Ursachen des Wachstums (Unsere Chancen zur Umkehr), Wien 1996, ISBN 3-218-00628-7
- Jan Roß: Die neuen Staatsfeinde, 2000, ISBN 3-596-14629-1, "Was für eine Republik wollen Schröder, Henkel, Westerwelle und Co.?" fragt diese "Streitschrift gegen den Vulgärliberalismus".
- Jan Ross: Regieren, Handwerk ohne Boden, Merkur 2000/11, ISBN 3-608-97019-3
- William Roth: The Assault on Social Policy, 2002
- P.J. O'Rourke: Eat the Rich (A Treatise on Economics), 1998
- Gilles Saint-Paul: Les économistes ont-ils une aversion pour la démocratie?, 1997?, WWW
- J.A.Schumpeter: Capitalism, Socialism and Democracy, 1942; Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, 1946, ISBN 3-8252-01720-4
- Tibor Scitovsky: The Joyless Economy (The Psychology of Human Satisfaction), 1992, ISBN 0-19507346-0
- Rolf Simons / Klaus Westermann (ed.): Standortdebatte und Globalisierung der Wirtschaft, 1997, ISBN 3-89472-194-4
- Burrhus Frederic Skinner: Jenseits von Freiheit und Würde, 1971
- Adam Smith: Wealth of the Nations, 1776, ISBN 0-87975-705-1
- Thorstein Bunde Veblen: The Theory of the Leisure Class, 1899, ISBN 0-14-018795-2, (deutsch: Die Theorie der feinen Leute, 1966); see also HyperTexts
- Bernhard Verbeek: Anthropologie der Umweltzerstörung, 1998, ISBN 3-89678-099-9
- Max Weber: Schriften zur Soziologie, 1911-1913, ISBN 3-15-009387-2
- Karl Georg Zinn: Globalisierungslehre ist Mythenbildung, Gewerkschaftliche Monatshefte 4/1997
- Karl Georg Zinn: Wie Reichtum Armut schafft, 1998, ISBN 3-89438-150-7
mehr]
|